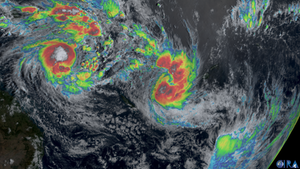Ein heller Lichtschweif sorgte am Sonntagabend bei einigen Menschen für Beunruhigung: Die Erscheinung, die in Süddeutschland und der Schweiz am Himmel zu sehen war, stammte wahrscheinlich von einem Meteoriten. Der Astronom Eike Guenther erklärt im Interview, wann solche Himmelskörper tatsächlich gefährlich sein können.
Herr Guenther, welche Art von Meteoriten können eine solche helle Lichterscheinung auslösen, wie die vom Wochenende?
Eike Guenther: Die Leuchterscheinung am Sonntag muss wohl sehr hell gewesen sein, und zwar zehn- bis 15-mal heller als der Vollmond. Aber Meteoriten können - auch wenn sie klein sind - sehr hell werden. Wenn Meteoriten in die Erdatmosphäre eintreten, dann erreichen sie normalerweise gar nicht den Erdboden, sondern brechen meist in 80 bis 100 Kilometern Höhe auseinander und es kommt nur noch Staub auf der Erde an. Nur bei einem relativ großen Brocken besteht überhaupt Hoffnung, dass davon etwas auf der Erde ankommt. Die Reste dieses Meteoriten sollen noch etwa faustgroß sein, er muss also vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre relativ groß gewesen sein.
Kann der Einschlag eines Meteoriten dieser Größe Schaden anrichten?
Der Einschlag eines faustgroßen Meteoriten richtet normalerweise keinen großen Schaden an. Denken Sie an den Einschlag des größeren Meteors von Tscheljabinsk. Damals war zum Beispiel nicht der Einschlag das Entscheidende. Wenn diese Körper in die Erdatmosphäre eindringen, haben sie Überschallgeschwindigkeit. Die Hauptschäden entstehen dann durch die Stoßwelle beim Überschallknall. Dadurch sind Fensterscheiben zerbrochen und Leute verletzt worden – also nicht durch den Einschlag, sondern durch den Knall.
Wie oft kommt es zu solchen Einschlägen?
Vor dem Tscheljabinsk-Ereignis hieß es immer, solche Einschläge seien äußerst selten. Danach haben Forscher die verfügbaren Satellitendaten angeschaut und die Statistik verbessert. Jetzt sagt man, dass ein Einschlag eines großen Körpers wie in Tscheljabinsk etwa alle zehn Jahre passiert.
Warum hören wir dann nicht so oft etwas darüber?
Drei Viertel der Erde sind mit Wasser bedeckt und große Flächen der Erde sind dünn besiedelt, wo solche Ereignisse auch nicht auffallen. Wenn man das bedenkt, kann man nachvollziehen, dass wir von solchen Ereignissen vielleicht nur alle dreißig Jahre oder seltener etwas hören. In Wirklichkeit passieren aber solche Einschläge wie in Tscheljabinsk ungefähr alle zehn Jahre. Und bei dem Meteoriten vom Sonntag würde ich tippen, dass sowas einmal im Jahr vorkommt. Vergangenes Jahr gab es einen ähnlichen Einschlag in Spanien. Ganz große Einschläge mit katastrophalem Ausmaß sind dagegen äußerst selten. In Deutschland haben wir beispielsweise das Nördlinger Ries und das Steinheimer Becken, die bei einem solchen Einschlag entstanden sind, aber das ist auch schon 15 Millionen Jahre her.
Wie schützen wir uns vor Meteoriteneinschlägen?
Früher haben sich Forscher nur Gedanken über ganz große Katastrophen gemacht, die sehr selten sind. Sie hatten errechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass im 21. Jahrhundert eine solche Katastrophe durch einen Meteoriten passiert, ein Promille beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Erdbeben oder einem Vulkanausbruch ums Leben zu kommen, ist also viel größer als durch den Einschlag eines solchen Himmelskörpers. Auf der anderen Seite: Erdbeben und Vulkanausbrüche kann man nicht verhindern. Gegen einen Meteoriteneinschlag kann man etwas machen. Und deswegen hat man sich damit beschäftigt.
Als gefährlich galten Gesteinsbrocken, die einen Durchmesser von 100 Metern oder mehr haben, die wollte man vollständig kennen. Um diese zu beobachten, wurden große Netzwerke aufgebaut. Die Idee ist: Wenn ein solch großer Brocken kommt, lenkt man ihn gezielt in andere Bahnen, so dass er nicht auf der Erde einschlägt.
Hat sich inzwischen an der Gefahreneinschätzung für kleinere Meteoriten etwas geändert?
Ein 100-Meter-Brocken kann eine große Katastrophe auslösen. Seit dem Tscheljabinsk-Ereignis wissen wir aber, dass auch Körper mit einer Größe von zehn Metern Schaden anrichten können. Um diese abzulenken, reicht aber die Zeit zwischen seiner Entdeckung und dem Einschlag nicht aus. Es wird aber ein Netzwerk aufgebaut, mit dem man solche Körper beobachtet und gegebenenfalls Warnungen ausgeben kann.
Und in der Tat haben Wissenschaftler inzwischen schon einen Asteroiden, der mit dem von Tscheljabinsk vergleichbar war, einige Stunden vorher registriert und seinen Einschlagsort korrekt vorausberechnet. Das war aber mitten in einer völlig unbesiedelten Gegend Afrikas, da war keine Warnung nötig. Es ist also schon gelungen, eine solche Vorwarnzeit zu erreichen. Bei Körpern wie in Tscheljabinsk kann man durch diese Methode eine Vorwarnzeit von einigen Stunden gewinnen.
Der Meteor am Sonntag kam scheinbar ziemlich überraschend. Wie gut haben wir den Raum um die Erde im Blick?
Wenn ein großer Körper im Anflug ist, kann man das Jahre vorher wissen. Es werden Techniken entwickelt, um diese gezielt abzulenken und auf eine andere Bahn zu bringen, damit sie nicht auf die Erde einschlagen. Kleine Körper mit wenigen Metern Durchmesser registrieren wir erst einige Stunden vorher. Bei dem Tscheljabinsk-Ereignis war das Problem auch, dass er aus Richtung der Sonne angeflogen kam. Da hatte man keine Chance, ihn vorher zu sehen.
Wie wirksam sind die Schutzmechanismen, die wir heute haben?
Bei der Beobachtung der großen Asteroiden sind die Forscher sehr erfolgreich. Sie haben schon die Bahnen von Tausenden von Objekten vermessen und festgestellt, dass von den bekannten keines auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Aber die Körper mit bis zu 100 Metern Durchmesser hat man nicht vollständig erfasst und jetzt beginnt man, auch sie zu beobachten. Dafür werden optische Teleskope verwendet, man schaut also den Nachthimmel an. Wenn ein Meteorit direkt aus der Richtung der Sonne anfliegt, kann man ihn mit dieser Technik deswegen schwer erfassen. Und tagsüber ist es mit optischen Mitteln natürlich auch schwierig, Himmelskörper zu beobachten. Dazu müsste man Radartechnik einsetzen. Und die bisherigen Netzwerke, die auch kleinere Brocken beobachten, funktionieren alle optisch.