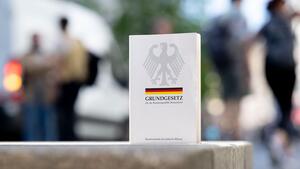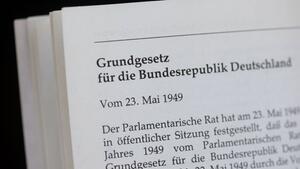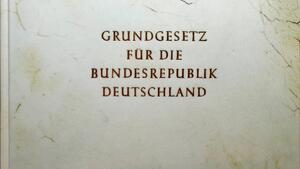Vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz der Bundesrepublik verabschiedet. Im Zuge des Jubiläums wird eine Forderung wieder lauter, für die sich Interessenverbände seit Jahren einsetzen: Sie fordern eine Ergänzung des Artikel 3 Absatz 3, um queere Menschen zu schützen.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik feiert in diesem Jahr das 75. Jubiläum. Seit 1949 schützt es unsere Demokratie und garantiert die Rechte der Menschen, die in Deutschland leben. Zu diesen Grundrechten zählen unter anderem die Meinungs- und Glaubensfreiheit und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Grundgesetz mehrmals verändert, neue Artikel wurden hinzugefügt, bestehende ergänzt oder aufgehoben. Über eine Änderung wird seit Jahren diskutiert: die Ergänzung von Artikel 3 um das Merkmal der "sexuellen Identität".
Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz besagt: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."
Ein Grundgesetz für alle
Die Initiative "Grundgesetz Für Alle" (GFA) setzt sich seit Jahren für die Ergänzung des Artikels ein, um Menschen vor Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität zu schützen. Ihre Petition haben inzwischen über 95.000 Menschen unterzeichnet (Stand 21. Mai 2024). Für eine Grundgesetzänderung sprach sich laut "queer.de" vor Kurzem auch die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, aus. Auch der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) gehört zu den Erstunterzeichnern der Initiative "Grundgesetz Für Alle". "Der verfassungsrechtliche Rechtsschutz für LSBTIQ (Anm.d.Red.: Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche und queere Menschen) ist bis heute noch nicht explizit gegeben", sagt Kerstin Thost, Pressesprecher*in des LSVD, unserer Redaktion.
Kritiker halten eine Ergänzung für Symbolpolitik und unnötig, denn das Grundgesetz schütze auch LSBTIQ. Bisherige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zeigten laut LSVD, "dass der Schutz der sexuellen Identität den im Rahmen des Abs. 3 genannten Diskriminierungsmerkmalen im Wesentlichen gleichkommt". In einigen Bundesländern schützen die Landesverfassungen explizit vor einer Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität. Zudem trat 2006 bundesweit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft, das die Diskriminierung aufgrund des Lebensalters und der sexuellen Identität verbietet. Allerdings gilt dieses nicht bei Diskriminierung durch Behörden.
Kriminalisierung queerer Menschen
Dass LSBTIQ ausreichend rechtlich geschützt seien, sieht der LSVD anders. Die Rechtsprechung biete keine dauerhafte Sicherheit in der Zukunft, denn die Gesetze könnten anders ausgelegt werden. Hinzu komme, dass die heutige Fassung des Grundgesetzes parallel zu Gesetzen existierte, die der Verfolgung queerer Menschen diente. Der Begriff "queer" bezieht sich im Kontext dieses Artikels auf LSBTIQ.
Denn auch nach dem Zusammenbruch des "Dritten Reiches" und dem Ende der NS-Herrschaft kam es jahrzehntelang zu einer "massiven Kriminalisierung und Entrechtung queerer Menschen vor allem durch den Paragrafen 175", sagt Kerstin Thost. Dieser noch aus dem Kaiserreich stammende Paragraf legitimierte die staatliche Verfolgung von schwulen und bisexuellen Männern. Endgültig gestrichen wurde der Paragraf erst vor 30 Jahren, im Jahr 1994. Und erst 2017 wurde ein Gesetz beschlossen, das alle Urteile, die nach 1945 gefällt wurden, aufhob. Inzwischen können Betroffene Entschädigungen beantragen.
"Wir denken, dass die Hürde für das Wegnehmen von bereits erstrittenen Rechten viel höher wäre, wenn der Rechtsschutz in Artikel 3, 3 da wäre."
Nachdem 1994 Menschen mit Behinderung in das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes aufgenommen wurden, seien homosexuelle Menschen die einzige Opfergruppe der Nationalsozialisten, die nicht explizit in Artikel 3, Absatz 3 GG genannt werden. "Es ist jetzt endlich Zeit, diesen Anfangsfehler zu korrigieren", sagt Thost.
Es geht dem LSVD und seinen Mitstreitern um mehr als nur um das Prinzip. "Es wäre ein wichtiges Zeichen und eine konkrete Verbesserung der Rechtslage für LSBTIQ, um aus der Unsichtbarkeit herauszutreten, aber auch deshalb, weil wir immer mehr Angriffe auf unsere Demokratie und auf Minderheitenrechte sehen", sagt Thost.
Man nehme eine Angst innerhalb der Community wahr. Denn ein Rechtsruck in Deutschland und Europa könnte bedeuten, dass Gesetze wie die Ehe für alle und das Selbstbestimmungsgesetz wieder zurückgenommen werden. "Wir denken, dass die Hürde für das Wegnehmen von bereits erstrittenen Rechten viel höher wäre, wenn der Rechtsschutz in Artikel 3, 3 da wäre", sagt Thost. Eine Ergänzung diene daher auch der Absicherung.
Queerfeindlichkeit nimmt zu
Die Sorgen sind nicht unbegründet, denn die Zahl der Straftaten gegen queere Menschen steigt seit Beginn der Erfassung 2017. Im Vergleich zum Vorjahr erfassten die Behörden 2023 fast 50 Prozent mehr Straftaten im Bereich "sexuelle Orientierung" und über doppelt so viele im Bereich "geschlechtsbezogene Diversität", wobei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist.
"Wir sehen, dass es eine Normalisierung an menschenfeindlichen Aussagen gibt, sich die Grenze des Sagbaren auch in demokratischen Parteien nach rechts verschiebt und dass aus Worten und Internetkommentaren auch Taten werden", sagt Thost.
Wie realistisch ist die Ergänzung von Artikel 3?
Politische Bestrebungen, um queere Menschen mehr zu schützen, gab es bereits. 2019 legten die Fraktionen von FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam einen Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes vor, der Vorschlag wurde jedoch nicht angenommen. Die Ampel hielt das Vorhaben 2021 im Koalitionsvertrag fest. Für eine Grundgesetzänderung braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit, die Ampel wäre also auf Stimmen der Opposition angewiesen.
Doch deren Zustimmung ist fraglich. Der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings, hält den Begriff "sexuelle Identität" für ungeeignet, denn "es wäre damit überhaupt nicht absehbar, was dadurch alles unter diesen zusätzlichen Gleichheitsschutz fallen würde. Einer solchen grundrechtlichen Blackbox wird die Union daher sicher nicht zustimmen." Zudem sagte die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende für Innen und Recht, Andrea Lindholz (CDU), dem "Spiegel", dass es keine Verhandlungen mit der Ampel zu Grundgesetzänderungen gebe.
Viel Zeit für eine Umsetzung bleibt der aktuellen Regierung in dieser Legislaturperiode nicht mehr. Und ob die nächste Regierung sich dieses Themas annehmen wird, darf bezweifelt werden.
Über die Gesprächspartner
- Kerstin Thost, Pressesprecher*in des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland
Verwendete Quellen:
- Gespräch mit Kerstin Thost
- Schriftliche Anfrage an Günter Krings, den rechtspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
- gesetze-im-internet.de: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
- campaigns.allout.org: Petition „Grundgesetz Für Alle“
- queer.de: Ferda Ataman fordert Diskriminierungsverbot von queeren Menschen in Verfassung
- lsvd.de: Ergänzung von Artikel 3 im Grundgesetz um "sexuelle Identität"
- antidiskriminierungsstelle.de: Antidiskriminierungsstelle des Bundes - Paragraph 175
- bmi.bund.de: Bundesweite Fallzahlen 2023 Politisch motivierte Kriminalität
- bundestag.de: Debatte über Stand der Beratungen zur „sexuellen Identität“
- spd.de: Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP
- spiegel.de: Warum viele Grundgesetzänderungen der Ampel auf Eis liegen


"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.