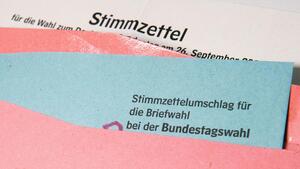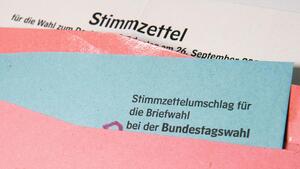Für die Nazis war Trude Nohr eine "arbeitsscheue und asoziale Herumtreiberin schlimmster Art". Sie deportierten die junge Frau erst ins Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, später nach Bergen-Belsen.
Abgemagert und mit Typhus infiziert, überlebte sie die Lager mit viel Glück. Als der Deutsche Bundestag Menschen, die von den Nationalsozialisten als "asozial" stigmatisiert wurden, im Jahr 2020 endlich als Opfergruppe anerkannte, war Trude Nohr neun Jahre tot.
Ihre Geschichte aber soll in Erinnerung bleiben: Am vergangenen Freitag wurde zu Ehren der verfolgten Kölnerin auf dem Gehweg vor der Martinstraße 26 ein Stolperstein verlegt. In dem Haus hat der bekannte Anwalt Rolf Bietmann seine Kanzlei, gegenüber befindet sich der Gürzenich. So verankert im Herzen der Stadtgesellschaft war Trude Nohr zu Lebzeiten nie.
Hubertine Konstantine Getrud Nohr, für alle nur Trude, wächst in ärmlichen Verhältnissen in Elsdorf und Köln auf. Als sie 14 Jahre alt ist, wird sie von ihrem Onkel vergewaltigt. Ihre Eltern zeigen die Tat an, doch die NS-Behörden bestrafen nicht den Täter, sondern Trude. Sie wird in Kinderheime verschoben und muss in privaten Haushalten zwangsarbeiten. In einem Polizeibericht aus dem Juni 1939 ist vermerkt, sie sei "auf Unzuchtwegen angetroffen worden" – demnach habe sie als Prostituierte gearbeitet.
Adolf Hitler hatte Prostitution in seiner Hetzschrift "Mein Kampf" als "Schmach der Menschheit" bezeichnet, die "unbedingt bekämpft" werden müsse. Prostituierte galten als "asozial" und wurden verfolgt – die zynische Doppelmoral der Nazis zeigte sich in Wehrmachtsbordellen, auch in Konzentrationslagern und besetzten Gebieten.
Trude Nohr verliebt sich mit 22 in einen Soldaten und wird schwanger. Der Liebhaber sucht das Weite. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes Josef wird sie im Frühjahr 1943 von der Polizei aufgegriffen und verhaftet. Nohr wird ohne Prozess zunächst im Kölner Messelager inhaftiert. Sie sei auch eine Nacht in der Kölner Gestapo-Zentrale, im El-De-Haus festgesetzt und verhört worden, erzählt sie später.
Ihren Sohn findet Nohr nach dem Krieg im Kinderheim
Am 5. Juni 1943 wird sie ins Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Sie erhält die Häftlingsnummer 20253 und ein Kleid mit schwarzem Winkel – dem Zwangserkennungszeichen für "Asoziale". Regelmäßig werden im Lager Hunde auf die Häftlinge gehetzt. "Trude hatte deswegen lebenslang ein Trauma und panische Angst vor Hunden", sagt ihr Großneffe Ludger Nohr bei der Verlegung des Stolpersteins.
Dass sie im Dezember 1944 ins KZ Bergen-Belsen deportiert wird, liegt womöglich auch an einem unvorsichtigen Brief ihres Vaters an die Reichskriminalpolizei, in dem er nicht nur um die Freilassung seiner Tochter bittet, sondern den "Berliner Herren" empfiehlt, sich auch mal "zur Nacht mit den Kleidern aufs Bett zu legen". Dem Vater wird in der Folge eine "staatsfeindliche Einstellung attestiert".
Die tägliche Konfrontation mit Hunger, Folter und Mord traumatisiert Trude Nohr für immer. Aber sie überlebt und kehrt 1945 ins zerstörte Köln zurück. Statt Solidarität erfährt sie Ablehnung, wenn sie vom KZ erzählt – und schweigt fortan lieber. Ihren Sohn findet sie im Kinderheim und muss 2000 Mark für die Unterbringung zahlen.
Weil sie keine Sozialhilfe beantragen will, sieht sie nur einen Ausweg: "Nach 1945 habe ich dann wirklich angefangen, das unsolide Leben zu führen, was sie mir immer vorgeworfen haben", wird sie Jahrzehnte nach dem Krieg dem Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte erzählen. Nach dem Krieg lebt sie für zwei Jahre in einem Bordell am Eigelstein. Ihr Sohn ist in dieser Zeit bei ihren Eltern untergebracht.
Später arbeitet Trude Nohr in der Großküche einer Bank. Verschiedene Versuche, für ihr Leid entschädigt zu werden, scheitern. Als von den Nazis sogenannte "Asoziale" entspricht sie nicht den Kriterien, die sie dafür berechtigen würden.
Als "asozial" bezeichnete das NS-Regime Menschen, deren Lebensweise oder Arbeitsverhalten als abweichend von der Norm und "gefährdend für die Volksgemeinschaft" galt. Dazu zählten zum Beispiel Obdach- oder Arbeitslose und Prostituierte.
In den 60er Jahren verliebt Nohr sich in Hassan, der als sogenannter Gastarbeiter bei den Ford-Werken arbeitet. In ihrer Familie kommt das nicht gut an – es kommt zu Zerwürfnissen. Auch die Beziehung zu ihrem Sohn leidet zeitweilig darunter.
1990 hilft ihr der Kölner Bundesverband für NS-Verfolgte, doch noch eine Entschädigung zu bekommen: eine monatliche Härtebeihilfe nach einem Kriegsfolgengesetz. Zuvor war ihre Rente mickriger als die normale Sozialhilfe gewesen. Im Jahr 2000 wird Trude Nohr in ihrer Wohnung überfallen und niedergeschlagen. Nur einen Tag später stirbt ihr Sohn Josef, der an Krebs erkrankt war.
Die Brandmauer müssen jetzt wir Bürger sein. Bleiben wir optimistisch und kämpfen für unsere Rechte, wie Trude es getan hat
Als "humorvoll, selbstbewusst, eigensinnig, geradeaus und äußerst resilient" beschreiben Wegbegleiter wie Großneffe Ludger Nohr oder Schauspieler Klaus Nierhoff, der sie in einem Erzählcafé kennengelernt hat, Trude Nohr im Nieselregen vor dem Gürzenich. Es zeuge von ihrer "sehr starken Persönlichkeit, dass die Verfolgung und das große Leid sie nicht gebrochen haben".
Jost Rebentisch, Geschäftsführer des Bundesverbands Information & Beratung für NS-Verfolgte, erinnerte am Tag nach dem CDU-Antrag für eine härtere Migrationspolitik, der mit Stimmen der extrem rechten AfD eine Mehrheit erhielt, an die Geschichte: Adolf Hitler sei von rechtskonservativen Eliten an die Macht gebracht worden, die meinten, ihn für ihre Zwecke nutzen zu können. "Wir müssen sehr gut aufpassen", so Rebentisch. "Die Brandmauer müssen jetzt wir Bürger sein. Bleiben wir optimistisch und kämpfen für unsere Rechte, wie Trude es getan hat." © Kölner Stadt-Anzeiger


"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.